Was bringt uns die EU? Zahlreiche EU-geförderte Projekte!
Für gezielte EU-Förderungen von lokalen und regionalen sowie grenzüberschreitenden Initiativen!

"Ferien für den Rasenmäher". Durch spielerische Motivation will das von der EU mitfinanzierte Projekt "GE_NOW" bis zum Projektende am 30. April 2026 Menschen in der Grenzregion Österreich/Schweiz dazu anregen, gemeinsam etwas für Klima- und Biodiversitätsschutz zu tun. Der Projekttitel "GE_NOW" soll verdeutlichen, dass "genau jetzt" die Zeit zum Handeln ist. Der Wettbewerb "Ferien für den Rasenmäher" im Mai 2025 lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, mitzumachen und dem Rasenmäher im heimischen Garten ein Monat lang eine Auszeit zu gönnen. Längeres Gras und vielfältigere Pflanzen bieten nämlich Lebensraum für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und andere Tiere. Darüber hinaus organisiert die Regionalentwicklung Vorarlberg eGen im Rahmen von "GE_NOW" Veranstaltungen und regt zu einer kreativen und spielerischen Auseinandersetzung mit den Themen Klima und Biodiversität an.
Die EU fördert "GE_NOW" über das Interreg-Programm mit rund 145.000 Euro.

Platz für Menschen statt Autos: So lautete das Ziel der von der EU geförderten Umgestaltung des Nibelungenplatzes vor dem Tullner Rathaus in Niederösterreich. Wo zuvor Autos geparkt haben, wachsen nun Bäume, laden aufgestellte Stadtmöbel zum Arbeiten und Pause-Machen im Freien ein und sorgt ein Nebelspiel für Abkühlung. Und für die zahlreichen Hochzeitspaare im Rathaus gibt es auch einen Instagram-tauglichen Ort, direkt vor den prächtigen Blumenbeeten hinter dem Minoritenkloster. 94 Prozent des Nibelungenplatzes wurden entsiegelt, nur 6 von 80 Prozent Asphaltfläche sind geblieben. Und was passiert nun mit den Autos? Für Beschäftigte sowie Kundinnen und Kunden soll es in der nahen Garage am Hauptplatz 150 Dauer-Parkplätze geben.
Nach einem umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess und einer Volksbefragung im Jahr 2021 sowie der genauen Planung im Jahr 2022 wurde der Nibelungenplatzes von Mai 2023 bis Juni 2024 umfassend umgestaltet. Das Projekt ist richtungsweisend in Bezug auf "zukunftsfitte" Stadtplanung und Klimaanpassung von Gemeinden. Die Finanzierung des Umbaus des Nibelungenplatzes erfolgte über das LEADER-Programm mit einer Fördersumme in Höhe von 148.000 Euro.
Im Jahr 2025 tragen Chemnitz in Deutschland und die Grenzstädte Nova Gorica in Slowenien sowie Gorizia in Italien (die beiden letzteren gemeinsam) den prestigeträchtigen Titel einer "Kulturhauptstadt Europas". Mit ihren jeweiligen Programmen streben die beiden diesjährigen "Kulturhauptstädte Europas" nicht nur danach, die kulturelle Vielfalt Europas zu feiern, sondern auch danach, nachhaltige Impulse für ihre regionale Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt zu setzen. Unter den Mottos "C the Unseen" für Chemnitz und "GO! Borderless" für Nova Gorica/Gorizia, laden die Städte dazu ein, neue Perspektiven auf ihre Geschichte, Kultur und Zukunft zu gewinnen.
In Österreich hat es bereits 3 "Kulturhauptstädte Europas" gegeben: 2024 Bad Ischl Salzkammergut, 2009 Linz und 2003 Graz. Auf Initiative der damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri 1985 ins Leben gerufen, blicken die "Kulturhauptstädte Europas" auf eine beispiellose 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Ziel der "Kulturhauptstädte Europas" – seit 1985 hat es bereits über 60 gegeben – ist es, die kulturelle Vielfalt aufzuzeigen, die Kulturszene der ausgewählten Städte ins Rampenlicht zu rücken und Impulse für deren langfristige Entwicklung auszulösen. Die ausgewählten Städte erhalten als Anschubfinanzierung 1,5 Millionen Euro im Rahmen des Melina-Mercouri-Preises aus Mitteln des EU-Kulturförderprogramms "Creative Europe". Im Jahr 2026 werden Trenčín in der Slowakei und das finnische Oulu den Titel einer "Kulturhauptstadt Europas" tragen.
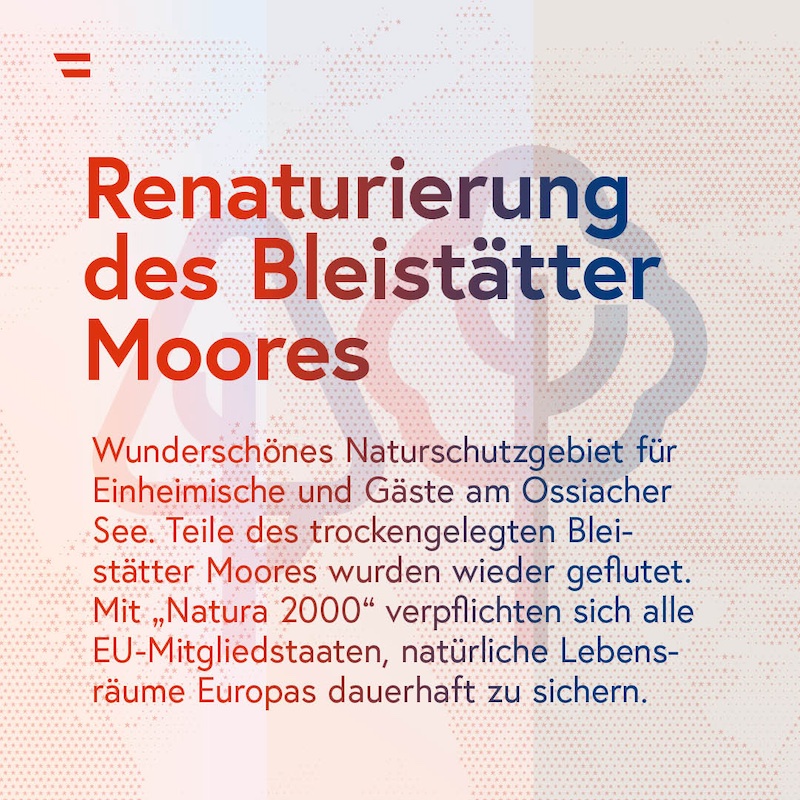
Sanfte Naherholung für Einheimische und Gäste am Ossiacher See. Seit 2017 wurden am östlichen Ende des zweitgrößten Kärntner Badesees ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen des in den 1930er-Jahren trockengelegten Bleistätter Moores wieder geflutet. Es entstanden ausgedehnte Flachwasserbereiche und Feuchtgebiete. Ein 7 Kilometer langer "Slow Trail" durchzieht diesen Naturraum und lädt zum gemütlichen Wandern und Beobachten von inzwischen rund 200 brütenden Vogel-, 700 unterschiedlichen Schmetterlings- und zumindest 14 verschiedenen Fledermausarten sowie 9 Arten von Amphibien ein. Seltene Arten, wie die nur 2 Millimeter große Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana), eine von 25 hier vorkommenden Schneckenarten, oder die Große Quelljungfer (Cordulegaster heros), eine von 31 hier festgestellten Libellenarten, wurden ebenso gesichtet wie seltene Pflanzenarten, etwa die Wassernuss (Trapa natans) und die Kleine Teichrose (Nuphar pumila).
Schon im Jahr 2002 erfolgte die Nominierung der Tiebelmündung zum "Natura 2000"-Gebiet. Mit dem Schutzgebietsnetz "Natura 2000" verpflichten sich alle EU-Mitgliedstaaten, die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft zu sichern. Rechtliche Grundlagen sind die Vogelschutzrichtlinie sowie die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU. 2010 hat das Land Kärnten die rund 101 Hektar große Tiebelmündung zum EU-Schutzgebiet erklärt.

Reparieren statt wegwerfen! Mit dem Reparaturbonus sparen Sie 50 Prozent der Reparaturkosten auf E-Geräte und schützen so auch noch zusätzlich das Klima und die Umwelt. Übernommen werden bis zu 200 Euro der Reparatur, -Service- oder Wartungskosten beziehungsweise 30 Euro für einen Kostenvoranschlag für Elektro- und Elektronikgeräte, wie beispielsweise defekte Handys, Laptops oder Kaffeemaschinen. Seit 16. September 2024 kann der Reparaturbonus auch für Reparaturen oder Wartungen von allen gängigen Fahrrädern sowie E-Bikes, Lastenrädern und Fahrradanhängern eingelöst werden. Insgesamt stehen für den Reparaturbonus bis 2026 130 Millionen Euro an EU-Mitteln von "NextGenerationEU" im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans zur Verfügung. Hinzu kommen 124 Millionen Euro aus nationalen Mitteln.

1 Gesundheitszentrum, 2 Staaten – eine EU-weit einzigartige Erfolgsgeschichte im Waldviertel! Das ist das erste europäische grenzüberschreitende Gesundheitszentrum im niederösterreichischen Gmünd. Nach 2 Jahren Bauzeit öffnete 2021 "Healthacross MED Gmünd" auf einem Areal direkt an der Grenze zu Tschechien seine Pforten. Seither werden pro Monat mehrere tausend Patientinnen und Patienten aus dem Waldviertel und Südböhmen medizinisch, pflegerisch und therapeutisch betreut. Das Gesundheitszentrum wird laufend erweitert und ausgebaut, 2024 etwa durch die Einrichtung neuer Kassenstellen sowie eines wöchentlichen Beratungsangebots für die Bevölkerung.
Mit der Initiative "Healthacross" bündelt das Bundesland Niederösterreich schon seit 2006 die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich mit Partnerorganisationen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Die mehrfach ausgezeichnete Initiative hat seitdem eine Vielzahl an Projekten umgesetzt, etwa die verbesserte Kooperation bei Notfällen, Rettungseinsätzen und der Neugeborenenversorgung oder einen verstärkten Wissensaustausch von Fachexpertinnen und -experten. Ziel ist es, einen gleichberechtigten und niederschwelligen Zugang zu einer hochwertigen, wohnortnahen, an die Bedürfnisse der Menschen abgestimmten Gesundheitsversorgung zu ermöglichen – dies- und jenseits der niederösterreichischen Grenze.
Die EU förderte das Gesundheitszentrum in Gmünd mit Baukosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).

Die EU förderte bis Ende 2024 im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans österreichweit das Projekt "Community Nursing" mit rund 54 Millionen Euro. Seit 1. Jänner 2025 führen einzelne Bundesländer "Community Nursing"-Projekte fort. Insgesamt wurden bis Ende 2024 115 Projekte in ganz Österreich umgesetzt. "Community Nurses" sind qualifizierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger. Sie agieren als primäre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Sie bieten Beratung zu Alltagsfragen und Förderungsmöglichkeiten an, führen Hausbesuche durch und organisieren Sprechstunden sowie Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Gesundheits- und Pflegethemen. Zusätzlich gibt es "School Nurses", die in Schulen tätig sind. Diese tragen zur Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bei und fördern den Aufbau von Gesundheitskompetenz.

Gemeinsam eine wunderschöne Europaregion entdecken. Damit punktet der "EuregioFamilyPass" bereits seit 2017. Die Vorteilskarte für Familien in der Europaregion (Euregio) Tirol-Südtirol-Trentino bietet über 1.000 Vorteilsangebote. Das Projekt trägt damit ganz praktisch dazu bei, das grenzüberschreitende Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Das Vorzeigeprojekt wurde außerdem beim "REGIOSTARS Awards"-Wettbewerb der Europäischen Kommission im November 2023 (Kategorie "Ein bürgernäheres Europa") ausgezeichnet.
Mit Stand Jänner 2025 wurden in der gesamten Europaregion bereits rund 305.500 Karten ausgestellt. Im "EuregioFamilyPass" fließen die Vorteilskarten aus 3 Regionen zusammen: der "Tiroler Familienpass", der "EuregioFamilyPass Südtirol" und die Trentiner "Family Card". Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle Familien, die in der Euregio ansässig sind und mindestens ein Kind im Alter von unter 18 Jahren haben. Die familienfreundlichen Vorteilsangebote reichen von ermäßigten Tickets für Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten über Vergünstigungen im Handel bis hin zu Rabatten bei diversen Dienstleisterinnen und Dienstleistern sowie Verkehrsbetrieben.

Graz-Klagenfurt in 45 Minuten – die Koralmbahn nimmt Fahrt auf! Eine 130 Kilometer lange neue Strecke, davon rund 50 Tunnel-Kilometer, über 100 Brücken sowie 23 moderne Bahnhöfe und Haltestellen: Die Koralmbahn ist Teil der neuen Südstrecke und wird mit 542,6 Millionen Euro aus dem Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan gefördert. Weitere Mittel stammen aus der "Connecting Europe Facility" der Europäischen Kommission.
Bereits 2 Jahre vor der Fertigstellung ging der gesamte Abschnitt auf Kärntner Seite zwischen Klagenfurt und St. Paul im Lavanttal für den Nahverkehr in Betrieb – mitsamt der modernisierten Lavanttalbahn und der sogenannten "Bleiburger Schleife". Denn die S-Bahn fährt seit 10. Dezember 2023 in 26 Minuten von Klagenfurt nach St. Paul im Lavanttal – 35 Minuten schneller als bisher. Ende 2025 soll die gesamte neue Strecke zwischen den Landeshauptstädten der Steiermark und Kärnten dann in Betrieb gehen. Infrastrukturelle Entwicklung, die uns voranbringt – gefördert von der EU!
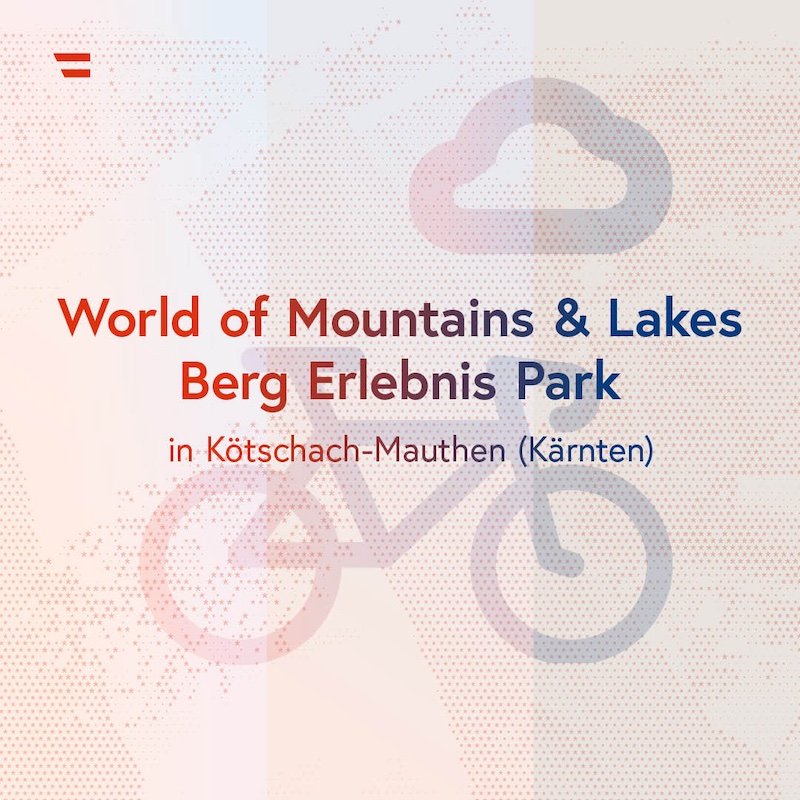
Hiken, Bouldern, Biken und Relaxen für die ganze Familie, und das gratis! Direkt am Eingangstor vom Drautal ins Gailtal und zur Marktgemeinde Kötschach-Mauthen steht der Gailberg. 2022 entstand dort, unterstützt durch die EU, der frei zugängliche "Berg Erlebnis Park". Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern stehen eine Boulder- und Motorik-Übungseinrichtung mit Kletterelementen aus Holz und Naturstein sowie diverse Geräte mit Eigengewichten zum Trainieren zur Verfügung. Fahrrad- und Mountainbikern bietet sich ein 400 Quadratmeter großer Fahrradparcours. Und auch an Ruheoasen mit "Chillout"-Lounge und Sonnenterrasse wurde gedacht.
Die EU hat den "Berg Erlebnis Park" mit 59.400 Euro im Rahmen des LEADER-Programms Region Hermagor gefördert.
Kurzbeschreibung Projekt "World of Mountains & Lakes Berg Erlebnis Park" (PDF)

Das Programm "Natura 2000" schützt den Biosphärenpark Wienerwald. Das Gebiet mit einer Fläche von 105.645 Hektar (das sind rund 110.000 Fußballfelder) ist ein besonderer Lebensraum für 855.000 Menschen und vielerlei Tier- und Pflanzenarten. In Niederösterreich sind 51 Gemeinden der Wienerwald-Thermenregion, im Wiener Teil 7 Bezirke mit dem Lainzer Tiergarten, den Landschaftsschutzgebieten Leopoldsberg und Liesing mit Maurer Wald, Gütenbachtal und Zugberg dabei. Ziel des Biosphärenparks ist es, den Schutz der biologischen Vielfalt mit der wirtschaftlichen sowie sozialen Entwicklung und der Erhaltung kultureller Werte nachhaltig zu verbinden. Zahlreiche Aktivitäten laden zum Mitmachen ein: So werden etwa passend zur Jahreszeit Tierspuren Führungen Obstbaumschnittkurse oder Kräuterwanderungen angeboten, in denen auf die Suche nach essbaren und heilsamen Trieben, Blüten, Früchten und Wurzeln gegangen wird.
Zahlreiche Angebote und Aktivitäten des Biosphärenparks, beispielsweise die Obstbaumschnittkurse, werden aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert.

Eine flächendeckende und schnelle Internetanbindung in ganz Österreich bis 2030. Das ist das Ziel der Initiative "Breitband Austria 2030". Dafür stellt die Europäische Union im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans rund 900 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. 150.000 bis 220.000 österreichische Haushalte können so einen Gigabit-fähigen Anschluss (das heißt, einen Breitbandanschluss mit sehr hoher Kapazität) erhalten. Die Vorteile einer flächendeckenden Verfügbarkeit von Gigabit-fähigen Zugangsnetzen sind breit gefächert: Mit "Breitband Austria 2030" soll unter anderem die Regionalität gestärkt, die Landflucht verhindert und die regionale Chancengleichheit verbessert werden. Gleichzeitig unterstützt der Breitbandausbau die Ausbildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Digitalisierung. Der Breitbandausbau in Österreich bedeutet Chancengleichheit, Bildung und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit – gefördert von der EU!

Wo Nachhaltigkeit auf urbane Lebensqualität trifft: Der EU-geförderte "Klimaboulevard" in der Thaliastraße im 16. Wiener Gemeindebezirk ist ein wegweisendes Projekt für die umweltbewusste Gestaltung von Städten. Nach der 2021 erfolgten Umgestaltung der Thaliastraße im Abschnitt vom Lerchenfelder Gürtel bis zur Feßtgasse wurde im Juni 2023 auch der zweite Abschnitt von der Feßtgasse bis zur Huttengasse als begrünter "Klimaboulevard" fertiggestellt. Allein in diesem Bauabschnitt haben 88 neue Bäume, 16 Nebelstelen, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und auf bis zu 6 Meter verbreiterte Gehsteige, die beliebte Einkaufsstraße im Herzen Ottakrings in einen gekühlten und angenehmen Aufenthaltsort für alle Passantinnen und Passanten sowie Bewohnerinnen und Bewohner verwandelt. Die Gesamtkosten für den zweiten Bauabschnitt belaufen sich auf 7.499.000 Euro, wovon 2.999.600 Euro durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wurden. 2024 starteten die Bauarbeiten für den dritten Abschnitt von der Huttengasse bis zum Karl-Kantner-Park. Bis Sommer 2025 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Auf den bereits neu gestalteten 2 Kilometern haben rund 180 Bäume, Wasserspiele sowie zahlreiche Staudenbeete und Mikrofreiräume Platz gefunden – weitere folgen.

Notebooks und Tablets für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist einer von 8 Punkten des Gesamtprogramms "Digitale Schule", das die Digitalisierung an Österreichs Schulen voranbringen soll. Für mehr Chancengleichheit zwischen Schülerinnen und Schülern werden seit dem Schuljahr 2021/22 alle Jugendlichen der 5. Schulstufe mit einem Tablet oder Notebook ausgestattet. Ziel der Initiative "Bereitstellung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler" sowie des Gesamtprogramms "Digitale Schule" des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist es, die digitalen Grundkompetenzen ab der Sekundarstufe zu fördern und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Die EU fördert das Programm "Digitale Schule" aus Mitteln des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans mit 171,7 Millionen Euro.

900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 120 Lehrlinge sowie Schülerinnen und Schüler in Ausbildung,mehr als 400 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2023/2024. Beigetragen zu dieser Erfolgsbilanz des Tiroler Traditionsunternehmens Thöni hat die EU über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Das Familienunternehmen aus Telfs ist einer der "Big Player" weltweit, wenn es um die Produktion hochwertiger Schläuche für Feuerwehren, den Bau und die Industrie sowie die Land- und Wasserwirtschaft geht.
Die EU förderte Thöni zwischen 2019 und 2022 aus Mitteln des EFRE mit rund 500.000 Euro, die das Unternehmen unter anderem in die Forschung investierte.

Schnurgerade. Das war die Enns an der Landesgrenze zwischen Salzburg und der Steiermark. Im östlichen Teil der Ortschaft Mandling liegt ein Abschnitt der Enns, der aufgrund der Flussbegradigungen und Regulierung ökologisch wie landschaftlich wenig attraktiv war. Durch ein EU-gefördertes Projekt wurden 2 ehemalige Mäander-Schleifen wiederhergestellt, so dass die Enns wieder frei fließen kann. Das schafft neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen, bietet dem Fluss aber auch mehr Platz bei Hochwasser. Im Rahmen des EU-geförderten LIFE IP IRIS-Projekts werden neben der Enns auch an weiteren Flüssen in ganz Österreich Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der ökologischen Qualität durchgeführt.
Für den Projektteil an der Salzburger Enns wurden insgesamt 1,3 Millionen Euro investiert. Die reinen Baukosten beliefen sich auf rund 750.000 Euro, wovon die EU im Rahmen des LIFE-Programms 378.000 Euro übernahm. Die restlichen Kosten wurden vom Bund, dem Land Salzburg und der Stadtgemeinde Radstadt bereitgestellt.
Bereits seit über 30 Jahren fördert das LIFE-Programm der EU in ganz Europa Projekte wie dieses. Das Programm dient der Förderung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten.
Mit Stand September 2024 wurden in Österreich im Rahmen von LIFE 139 Projekte mit Gesamtprojektkosten in Höhe von 366 Millionen Euro umgesetzt, wovon die EU 256 Millionen Euro beisteuerte.

Gesundheitsversorgung – rasch, effizient, wohnortnah. Das sind die Grundgedanken hinter dem EU-geförderten Programm zur Attraktivierung und Förderung der Primärversorgung in Österreich. Eine starke Primärversorgung bringt mehrere Vorteile für Menschen in Österreich: Zum einen ermöglicht sie einen niederschwelligen Zugang zu medizinischer Versorgung, auch in ländlichen Gebieten und zu Tagesrandzeiten. Zum anderen steht den Patientinnen und Patienten ein vielfältiges Leistungsangebot zur Verfügung: Neben der Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen stehen Gesundheitsförderung, Prävention sowie die psychosoziale Gesundheit im Fokus.
Ein Beispiel für eine Primärversorgungseinheit (PVE) mit einem derartigen Angebot ist das Primärversorgungszentrum Reininghaus in Graz (Steiermark). Seit Jänner 2024 betreuen dort 3 Allgemeinmedizinerinnen und ein Team aus unter anderem Diplompflegerinnen, einem Physiotherapeutensowie einer Hebamme die ihre Patientinnen und Patienten. Weitere Standorte und PVE, die in Österreich durch die EU gefördert werden konnten, finden Sie auf der PVE-Landkarte der "Plattform Primärversorgung".
Die EU fördert die Primärversorgung im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans mit insgesamt rund 100 Millionen Euro. Bis Mitte 2026 sollen mindestens 155 Projekte in der Primärversorgung, davon 45 neue PVE, in ganz Österreich gefördert werden. Mit Stand Jänner 2025 tragen bereits 83 PVE zu einer starken Primärversorgung in Österreich bei.

Klimafreundlich unterwegs mit den "Öffis". Das ist einer der Schwerpunkte des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans. Mit dem Programm EBIN (kurz für "Emissionsfreie Busse und Infrastruktur") fördert die EU umweltfreundliche Mobilität und unterstützt Unternehmen bei der Flotten-Umstellung auf Busse, die statt Diesel zum Beispiel Strom und Wasserstoff tanken. Auch die erforderliche Lade- beziehungsweise Betankungsinfrastruktur wird über EBIN gefördert. Die Wiener Linien haben damit bereits die Buslinien 17A, 61A, 61B, 64A und 64B sowie 70A, 71A und 71B auf 12 Meter lange E-Busse umgestellt. Bis Ende 2025 sollen insgesamt 60 E- sowie 10 Wasserstoffbusse für noch sauberere Luft in Wien sorgen. Geladen, gewartet und repariert werden die E-Busse in einem neuen energieeffizienten Kompetenzzentrum für E-Mobilität im 23. Wiener Gemeindebezirk. Bis Ende 2025 sollen in Wien übrigens auch alle Hop-On-Hop-Off-Busse elektrisch Touristinnen und Touristen durch die Stadt führen.
Weitere abgasfreie "Öffi-Busse" sind beispielsweise auch bereits in Vorarlberg, Salzburg und im Mürztal unterwegs. Bis zum 2. Quartal 2026 sollen mindestens 682 aller im Innerösterreichischen Linienverkehr fahrenden Busse auf emissionsfreien Betrieb umgestellt werden.
Die EU fördert diesen Umstieg bis 2026 mit 256 Millionen Euro aus Mitteln des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans.

Lungauer Schöpsanes, Kletzenbrot oder Krautstrudel. Europa bringt auch regionale Kost zurück auf den Teller, zum Beispiel über den Verein "Lungauer Kochwerk". Dabei handelt es sich um eine im Herbst 2016 von Bäuerinnen und Lehrerinnen im Salzburger Lungau gegründete Kochschule. Über ein möglichst vielseitiges Kursangebot möchte sie die Menschen wieder vermehrt zum Selberkochen einladen. Und die Angebote sind vielfältig, wie auch die Geschmäcker des Lungau: Ob Profi- oder Hobbyköchinnen und -köche, Schulkinder oder Familien – für jede Zielgruppe ist etwas dabei. Im Vordergrund steht unter anderem, den Menschen den Wert des Kochens und von regional erzeugten Nahrungsmittel näherzubringen. Auf der Website des "Lungauer Kochwerks" finden sich auch Rezepte zum Nachkochen. Zusätzlich listet der virtuelle Bauernmarktladen "Lungauer Speis" alle Lungauer Direktvermarkter auf, gibt Informationen über Produkte und stellt einen Bestell-Shop zur Verfügung – mit regionalen Produkten "made in Lungau".
Die EU hat das "Lungauer Kochwerk" und die "Lungauer Speis" im Rahmen des LEADER-Programms mit einer Starthilfe von 55.000 Euro gefördert.

Kürbiskernöl und steirische Äpfel auf dem Prüfstand: Bereits seit über 20 Jahren widmet sich das Institut Dr. Wagner mit Sitz in Lebring, Südsteiermark, der Qualitätssicherung von Lebensmitteln. Denn die Sicherheit von Lebensmitteln ist wichtig für unsere Gesundheit und ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Zu den Leistungen des Familienunternehmens zählen unter anderem die Qualitätssicherung und Verkehrsfähigkeitsprüfung von Kürbiskernöl, der steirischen Apfelwirtschaft sowie die österreichweite Prüfung von Obst und Gemüse für das Gütesiegel der AgrarMarkt Austria (AMA). Unter dem Motto "Wir messen Qualität" werden jährlich über 10.000 Prüfberichte erstellt.
Ein im September 2023 neu eröffnetes Spurenanalytik-Labor dient zudem als Informations- und Servicezentrum. Das hochspezialisierte Team in Lebring bietet Exkursionen, Schulungen, Führungen und Verkostungen an, damit die Qualität regionaler Lebensmittel auch für die Besucherinnen und Besucher sichtbar und sinnlich begreifbar wird. Das Labor selbst umfasst 1.200 Quadratmeter Fläche, wurde aus Holzriegelelementen gebaut und mit einer Lärchenholzfassade verkleidet. Die Errichtung des Gebäudes erfolgte unter anderem mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Newsdetail - EU-Förderung für regionale Entwicklung (efre.gv.at)

EU-Netzwerk für den nachhaltigen Skitourismus der Zukunft: Skigebiete in Österreich und Europa sind mit einer gemeinsamen Herausforderung konfrontiert: Sie müssen die Auswirkungen des Klimawandels bewältigen. Das EU-geförderte Interreg-Forschungsprojekt "TranStat" ("Transitions to Sustainable Ski Tourism in the Alps of Tomorrow") möchte dabei helfen, gemeinsam Ideen für den Übergang zu nachhaltigen Gebirgsdestinationen zu entwickeln und in der Praxis umzusetzen.
Universitäten und Forschungseinrichtungen werden mit Stakeholdern wie Behörden und Unternehmen in den Wintertourismusregionen zusammengeführt, um die größten Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze zu definieren. Im Rahmen von "TranStat" kommen bei Workshops beispielsweise Liftbetreiber sowie Tourismusvertreterinnen und -vertreter, aber auch die lokale Bevölkerung zu Wort. Die Idee dahinter: Langfristig tragfähige, nachhaltige Konzepte können nur entstehen, wenn alle Interessensgruppen mit einbezogen werden.
In 9 Testskigebieten in den Alpen ist das Projekt bereits angelaufen, unter anderem im Biosphärenpark Großes Walsertal in Vorarlberg, in St. Corona am Wechsel in Niederösterreich sowie weiteren Skigebieten in Frankreich, Slowenien, Italien und der Schweiz. In St. Corona am Wechsel ist es in den vergangenen Jahren beispielsweise erfolgreich gelungen, für die Besucherinnen und Besucher ganzjährige Sportangebote zu entwickeln.
Aus dem Alpenraumprogramm des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) wird das Projekt "TranStat", das von November 2022 bis Oktober 2025 läuft, mit rund 1,6 Millionen Euro gefördert.

Ein Naturparadies vor der Haustür, das sich über mehrere benachbarte Ortschaften erstreckt: Ein Beispiel dafür ist das "Naherholungsband" rund um die oberösterreichische Bezirkshauptstadt Vöcklabruck. Mit einer EU-Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben sich die Orte der Umgebung zusammengetan und ein gemeinsames Erholungsgebiet geschaffen – unter anderem durch das Einbinden bestehender Freizeitareale, einheitlich ausgeschilderte Wanderwege und Radrouten in der Region. Zudem wurden bestehende Freizeiteinrichtungen und Erholungsgebiete erneuert und vernetzt: die Puchheimer Au, die große Waldfläche im Norden von Vöcklabruck, der Spielplatz in Puchheim und Wanderwege in Timelkam wurden angeschlossen.
Die EU förderte das "Naherholungsband Vöcklabruck" über den EFRE mit rund 275.000 Euro.
Informationen und Fotos zum "Naherholungsband Vöcklabruck" (Europäische Union, EFRE)
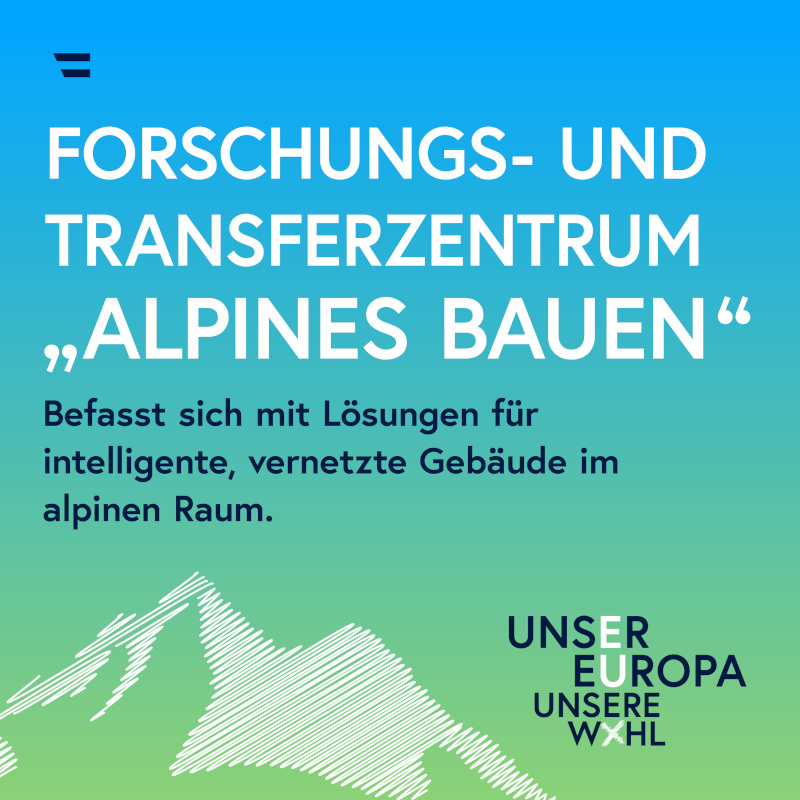
Täler sinnvoll und nachhaltig nutzen. Das ist das Ziel des von der EU geförderten Forschungs- und Transferzentrums "Alpines Bauen" in Salzburg. Denn dauerhaft nutzbarer Siedlungsraum in Österreich ist ein knappes Gut. Österreichweit eignen sich nur 40 Prozent der Gesamtfläche der Republik dazu, in Salzburg sind es überhaupt nur 20 Prozent. Das Land reagiert damit auf den Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum mit einem Forschungscluster, der auf optimale Nutzung vorhandener Ressourcen abzielt. Salzburg dient durch seine Höhenlagen als Reallabor für verschiedene Raumtypen und Klimaverhältnisse im Alpenraum. Das Forschungs- und Transferzentrum "Alpines Bauen" entwickelt Lösungsvorschläge für ressourcenschonendes Bauen von ökologischen und leistbaren Wohnräumen, unter Einbeziehung erneuerbarer Ressourcen und intelligenter Technologien.
Das Investitionsvolumen des Projekts "Alpines Bauen" beträgt rund 3 Millionen Euro und wird von der EU durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert.
Informationen zum Forschungs- und Transferzentrums "Alpines Bauen" (Europäische Union, EFRE)

Das "Gebäude der Zukunft" steht im Burgenland: Das "Energetikum – Living Lab" im burgenländischen Pinkafeld gilt als eine der führenden Forschungseinrichtungen im Bereich Energieeffizienz in Österreich. Das Zentrum bietet modernste Infrastruktur für internationale Forscherinnen und Forscher sowie Studierende der Fachhochschule (FH) Pinkafeld, während es selbst als Bürogebäude dient. Die Forschung konzentriert sich auf das "Gebäude der Zukunft", das sein Energiemanagement an reale Nutzungsbedingungen und externe Faktoren anpasst. Verschiedene Projekte vernetzen Einzeltechnologien, erforschen Wechselwirkungen und optimieren ihre Abstimmung. Über 2.000 Sensoren sammeln Daten zu Wetterbedingungen und Energieflüssen für komplexe Analysen. Das Hauptziel ist ein zentrales Energiemanagement, das trotz steigendem Verbrauch Kosten einspart. Dieses Projekt verbessert nicht nur die Forschungsbedingungen, sondern schafft auch hochwertige Arbeitsplätze und zieht neue internationale Forschungsprojekte an.
Die EU fördert das Projekt "Energetikum – Living Lab" über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit rund 1,44 Millionen Euro. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 2,34 Millionen Euro.
Informationen zum Forschungszentrum "Energetikum – Living Lab" (Europäische Union, EFRE)
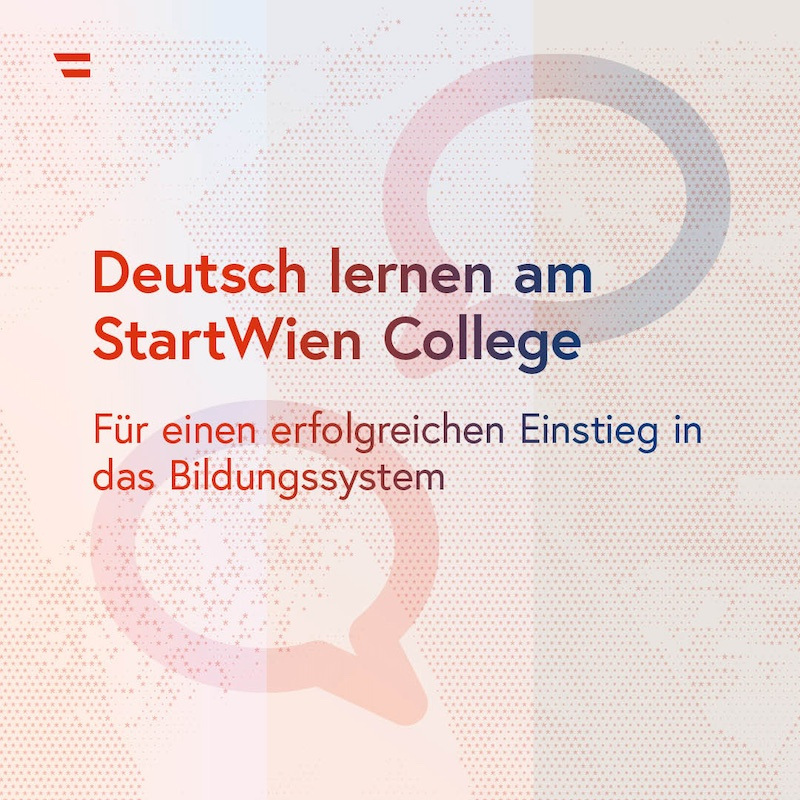
Deutsch lernen im "StartWien College". Mitfinanziert durch die Europäische Union, soll das College neu zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Einstieg und den erfolgreichen Weg im Wiener Bildungssystem ermöglichen. Das Projekt der Stadt Wien bietet den Lernenden intensiven Deutschunterricht, eine Erweiterung der englischen Sprachkenntnisse, die Vertiefung digitaler und mathematischer Kompetenzen, sowie die Möglichkeit der Absolvierung einer staatlich anerkannten Deutschprüfung an. Darüber hinaus bereiten die Betreuerinnen und Betreuer die Teilnehmenden individuell auf den Besuch weiterführender Schulen oder auf mögliche Ausbildungsplätze vor.
2024 nahmen insgesamt 256 Jugendliche und junge Erwachsene an dem Projekt teil. Der Großteil der Teilnehmenden kam aus den Ländern Syrien, Serbien, Afghanistan, Ungarn und der Ukraine. Ab März 2025 stehen insgesamt 200 Kursplätze laufend zur Verfügung.
Die EU fördert das Jugendcollege StartWien im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) mit rund 760.000 Euro.
Im März 2024 wurde die Online-Plattform "Kulturpool" mit über einer Million Objekten in Bild, Text, Ton, Video und auch 3D erstmals veröffentlicht. Im "Kulturpool" kann man zentral in den Online-Sammlungen von Kulturinstitutionen aus ganz Österreich suchen. Gleichzeitig dient die Wissens- und Rechercheplattform als nationaler Aggregator und sorgt dafür, dass das reiche Kulturerbe Österreichs über die Plattform "Europeana" in ganz Europa zugänglich ist.
Das Naturhistorische Museum Wien betreut die Plattform "Kulturpool" und dient gleichzeitig als zentrale Kompetenzstelle für Digitalisierung in ganz Österreich. Konferenzen, Webinare und Online-Cafés bieten den Stakeholdern eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Kompetenzaufbau in verschiedenen Themen rund um Digitalisierung. Über das Förderprogramm "Kulturerbe digital" werden in den kommenden Jahren weitere Institutionen mit ihren digitalen Sammlungen in den "Kulturpool" aufgenommen. Somit wächst die Anzahl der verfügbaren Kulturerbe-Objekte stetig.
Das Portal "Kulturpool" ist Teil der Strategie "Kulturerbe digital" des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS). Der Aufbau des "Kulturpools" wird aus Mitteln des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans mit 1,5 Millionen Euro finanziert; 15 Millionen Euro fließen in das Förderprogramm "Kulturerbe digital".
Ein Vorzeigeprojekt, das Baukultur, umweltbewussten Denkmalschutz und Museumsinnovation verbindet! Das Volkskundemuseum Wien – untergebracht im denkmalgeschützten Gartenpalais Schönborn im Wiener Bezirk Josefstadt – wird aktuell generalsaniert. Es gilt als eines der großen internationalen ethnographischen Museen Europas. Die Sanierung ist Teil des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans und wird bis 2026 mit insgesamt 25 Millionen Euro gefördert. Der Baustart erfolgte im Jänner 2025, die Wiedereröffnung des Museums ist für Juni 2026 geplant. Neben den Sanierungsarbeiten zum Erhalt der historischen Substanz wird es auch eine inhaltliche Neuausrichtung der Museumsarbeit geben. Es entsteht ein modernes Museum, das sich national wie international als Ort der Vielfalt und Offenheit präsentieren möchte.